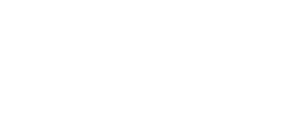DIE GESCHICHTE DER KUNST FOLGERICHTIG ZU DENKEN
Logiki – ein magisches Wort aus dem griechischen Wortschatz. Die Logik ist der Maßstab für alle Erscheinungen des menschlichen Zusammenlebens. Man braucht nur ein bisschen Vernunft, um die Logik zu verstehen. Sie bietet eine große Chance für die Menschheit in Frieden miteinander zu leben. Das Logische ist ruhig, das Unlogische ist aggressiv. Logik führt zur inneren Freiheit, nur so kann man erkennen, was gut ist und was schlecht ist.
Die richtigen Konsequenzen
Die Logik ist die Lehre vom folgerichtigen Denken (denkende Kunst). Sie befasst sich mit dem Ergründen von richtigen Konsequenzen aus richtigen Prämissen (Voraussetzungen).
Erstmal wurde die Logik von Aristoteles angewandt, indem er die Form und nicht allein den Inhalt eines Denkvorgangs prüfte. Dabei entstand ein Syllogismus (logischer Schluss), der sich aus zwei Prämissen (Voraussetzungen) zusammensetzt und zu einem dritten Urteil, der Konklusion führt. Ein Beispiel hierfür ist, dass erstens alle Menschen sterblich sind und zweitens der Satz „Ich bin ein Mensch“ drittens zur Konklusion (Schlussfolgerung) führt: „Also bin ich sterblich.“ Syllogismus war für Aristoteles das grundlegende Instrument der Logik. Ein anderes Beispiel des Syllogismus ist: Kein Pferd hat Hörner, aber alle Pferde sind Wirbeltiere, also es gibt einige Wirbeltiere, die keine Hörner haben.
Engel und Stecknadeln
Aristoteles entwickelt die Lehre vom beweisenden Schluss (Syllogismus) mit ihren Grundbegriffen Figur, Modus, Obersatz, Mittelsatz und Untersatz. Aristoteles Ansichten blieben vorherrschend und seine Logik war insbesondere für monastische Debatten (Diskussionen unter Mönchen beziehungsweise Geistllichen) über die Natur Gottes bedeutsam, z.B. wie viele Engel auf einem Stecknadelkopf tanzen können.
Die Logik ist eng verwandt mit der Sprach-Philosophie. Dazu gehört die logische Analyse der Sprache, das Nachdenken. Die Philosophie ist beinahe so alt wie die Sprache selbst. Schon Platon und Aristoteles, aber auch die Stoiker und viele Philosophen des Mittelalters haben sprach-philosophische Problemstellungen diskutiert.
Tiere haben keine Gedanken
So wird beispielsweise in Platons Dialog (Kratylos) das Problem aufgeworfen, ob sprachliche Ausdrücke von Natur aus das bedeuten, was sie bedeuten oder ob ihnen nur aufgrund von Konventionen eine bestimmte Bedeutung zukommt.
Aus Sicht der Sprachanalyse können Tiere, weil sie keine Sprache beherrschen, auch keine Gedanken haben.
Hauptziel der ersten Analytik (Analytikon Proteron) und zweiten Analytik (Analytikon hystron) ist der Nachweis von sprachlichen Gesetzmäßigkeiten, die den Ansprüchen wissenschaftlicher Erkenntnis genügen.
Unterschiedlich benannt
Die Logik ist in ihrer Geschichte verschieden benannt worden. Diese unterschiedlichen Benennungen beruhen zum Teil auf ihrer systematischen Eigenart, zum Teil auf ihrem Lehrgegenstand und zum Teil auf ihren Leistungsfähigkeiten. Weil also die verschiedenen Gesichtspunkte ihrer Benennung nicht homogen (gleichmäßig) sind, können ihre verschiedenen Benennungen ein verschiedenes Verständnis einschließen, müssen es aber nicht. Andererseits können verschiedene Auffassungen der Logik unter einen gemeinsamen Namen auftreten.
Nach Platon ist die Logik dialektische Episteme (Wissenschaft), soweit sie von ihr ausgebildet ist. Sie befasst sich mit Analyse und Synthese von Begriffen und dient vornehmlich der Erkenntnis der Seienden, um die Ideen zu begreifen. Damit beinhaltet sie einmal die Technik der Argumentation und zum anderen eine Metaphysik des Absoluten.
Lehre vom Verstand
In älteren deutschsprachigen Werken heißt Logik „Vernunftkunst“ oder „Verstandeslehre“. In der Terminologie der deutschen Aufklärung dagegen wird die Logik im subjektiven Sinne gebraucht, um Erkenntnis und Wahrheit zu erkennen. Sie wird als Vernunftlehre bezeichnet.
Mit der Entwicklung der mathematischen Naturwissenschaften und der hier ausgebildeten Praxis des wissenschaftlichen Vorgehens wird der Logik in ihrer syllogistischen Form nur noch eine beschränkte Funktion zuerkannt.
Dabei wird entsprechend dem Erfolg naturwissenschaftlicher Methoden auch die Logik an dem Anspruch gemessen, die Entdeckung neuer Wahrheiten zu ermöglichen. Die moderne Logik beginnt mit dem Bemühen Gottlob Freges (Logiker des 19. Jahrhunderts), durch eine systematische Anwendung des Funktionsbegriffes Logik und Mathematik auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen. Dazu ergänzte Frege, der nicht nur Zahlen, sondern auch beliebige Gegenstände zuließ, die für die Logik sehr wichtigen Wahrheitswerte, nämlich das Wahre und das Falsche.
Konstantin Gorlas
Philospoh